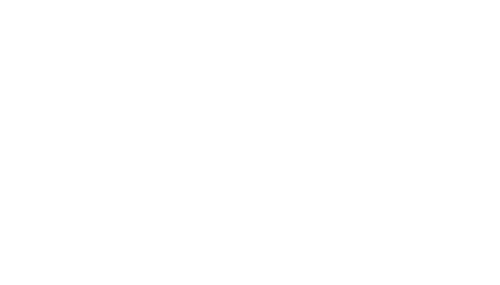Das Leningrader Haus des Radios

Wenn wir die Namen von Olga Fjodorowna Bergholz oder Maria Grigorjewna Petrowa hören, denken wir sofort an den Rundfunk im belagerten Leningrad. Seine Rolle war außerordentlich wichtig, weshalb wir im heutigen Artikel genauer darüber berichten.
Zuerst widmen wir uns dem terrakottafarbenen Gebäude an der Ecke zwischen der Malaja Sadowaja und der Italjanskaja-Straße. Ebenda befand sich während der Blockade das Haus des Leningrader Radios. Das majestätische Gebäude entstand zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Sitz der Sankt Petersburger Adelsversammlung – einer Art Klub für Kaufleute, Adlige und Beamte, wo (Masken-)Bälle, literarische Lesungen und Theaterstücke stattfanden.
Während des Ersten Weltkriegs wurde in dem Gebäude ein Lazarett der japanischen Rotkreuz-Gesellschaft eingerichtet. Nach 1917 eröffnete dort der Palast der proletarischen Kultur und später ein Kino. Im Jahr 1932 entstand an diesem Ort der Leningrader Rundfunk.
Vor dem Krieg war das Mediensystem in Leningrad gut organisiert: Zeitungen und verschiedene Zeitschriften wurden herausgegeben, es gab Kinos, Theater und Radiosender. Doch nach dem Beginn der Blockade waren viele Verbindungskanäle durchtrennt und der zentrale Rundfunk wurde zur wichtigsten und schnellsten Informationsquelle der Bevölkerung. Morgens versammelten sich die Menschen an den Lautsprechern, um die aktuellen Nachrichten und Neuigkeiten von der Front zu hören. Eines der Symbole des belagerten Leningrad ist das Metronom, dessen Klang ebenfalls im Radio zu hören war: schnelles Schlagen bedeutete Alarm, langsames Schlagen Entwarnung.
Neben der reinen Information über der Rundfunk ab Herbst 1941 noch eine weitere wichtige Funktion: die psychologische Unterstützung der Bürger. Regelmäßig wurden Gedichte, Erzählungen und Briefe von der Front vorgetragen und Sondersendungen durchgeführt. Die Namen und Stimmen der Sprecher kannte die ganze Stadt. Es wurde ohne Unterbrechungen gesendet: Die Angestellten von Lenradio arbeiteten unter denselben Bedingungen wie alle anderen, häufig ohne freie Tage und mit maximaler Hingabe, denn schließlich wussten sie, welche Rolle der Rundfunk in der belagerten Stadt spielte. Er war das Fädchen, das Leningrad mit dem Großen Land verband. Dank des Radios hörte nicht nur Leningrad, sondern die ganze Welt die Übertragung der Siebten Sinfonie von D.D. Schostakowitsch aus dem Großen Saal der Philharmonie.
Wenn von den Rundfunksprechern des belagerten Leningrad die Rede ist, dann erinnert man sich zumeist an Olga Fjodorowna Bergholz, die „Muse des belagerten Leningrad“. Allerdings hatte Bergholz noch viele Kollegen – hier nennen wir einige von ihnen:
Über Maria Grigorjewna Petrowa haben wir bereits berichtet. Viele Teilnehmer unserer „AIK“ kennen ihre Stimme noch aus Kindertagen. Wenn sie in der Sendung das Märchen „Teremok“ vortrug, konnte man sich nur schwer vorstellen, dass alle Figuren von nur einer Person gespielt wurden.
Außerdem erinnern sich viele an die Worte „Landsleute, hört! Hier spricht Leningrad!“, mit denen die Sprecherin Nina Fjodorowa ihre Sendungen begann.
Doch im Radio waren nicht nur Rundfunksprecher, sondern auch Schauspieler zu hören. Nina Tschernjawskaja war Schauspielerin am sogenannten „Theater am Mikrofon“, das beim Leningrader Rundfunk gegründet wurde. Sie trug literarische Werke, aber auch Berichte des Informbüro vor.
Der Schauspieler Wladimir Lebedjew betätigte sich im Jahr 1929 erstmals als Lektor im Radio. Zeitgenossen erinnern sich, dass seine Stimme spöttisch, bisweilen schroff, bisweilen sentimental, doch psychologisch ausgewogen und der jeweiligen Situation angemessen war. Als Regisseur schuf Lebedjew eine Reihe von Sendungen und Hörspielen.
Gemeinsam mit seinem Schauspieler- und Radiomacherkollegen Wladimir Jarmogajew legte er den Grundstein für die literarische Hörfunkbühne. Ihre Auftritte mit klassischen Werken waren bei den Leningradern außerordentlich beliebt.
Auch der Schriftsteller Wsewolod Wischnewski, der sich 1941 und 1942 im belagerten Leningrad aufhielt, trat im Radio auf.
Im September 1941 fand eine stadtweite Kundgebung junger Menschen statt, bei der über 2500 Komsomolzen im Namen der Leningrader Jugend schworen, ihre Heimatstadt um jeden Preis zu verteidigen. Wsewolod Wischnewskis Rede bei dieser Kundgebung wurde auf Schallplatte veröffentlicht und an die Truppenteile weitergeleitet.
Das Leningrader Radio führte zudem eine umfassende Berichterstattung durch. Der Rundfunkjournalist Lasar Magratschow ging mit insgesamt etwa eintausend Reportagen auf Sendung. Dieses Archiv diente als Grundlage für zukünftige Forschungen zur Blockade.
Sein Kollege, der Korrespondent Matwej Frolow, berichtete von der Front, aus Partisaneneinheiten und aus der belagerten Stadt. Er erzählte als erster die Geschichte von Tanja Sawitschewa. Auf seinen Bändern sind die Stimmen von Olga Bergholz, Dmitri Schostakowitsch und anderen erhalten.
Die Stimmen der Leningrader Rundfunksprecher waren den Menschen sehr vertraut, denn sie hörten sie jeden Tag. Man liebte die Stimme David Bekkers, da er nach einem Luftalarm Entwarnung gab. Außerdem arbeitete er als Moderator in der Philharmonie, wo er auch während der Blockade die Schauspieler auf der Bühne ankündigte.
Die Stimme Michail Melaneds jedoch versetzte die Menschen in Aufregung, denn er gab den Beginn des Luftalarms bekannt. Zudem moderierte er offizielle Sendungen. Man nannte ihn den „Leningrader Lewitan1“. Er war es, der am 27. Januar das langersehnte Ende der Blockade verkündete. Der siegreiche Salut wurde ebenfalls im Radio übertragen.Auch heute ist das Leningrader Haus des Radios noch in Betrieb: Dort befindet sich die Residenz des Kreativlabors MusicAeterna.
An der Wand des Gebäudes ist eine Gedenktafel zu sehen, auf der die Geschichte des Hauses des Radios in Kurzform zu lesen ist und die Namen einiger Sprecher aufgelistet werden. In einer Nische steht ein kleines Denkmal, das Olga Bergholz gewidmet ist.
1 Sprecher beim sowjetischen Rundfunk. Während des Krieges trug er die Berichte des Sowinformbüro vor.
Quellen:
Artikel über den Leningrader Rundfunk auf der Website des Gedenkbuches des belagerten Leningrad
Artikel über David Bekker auf der Website der Philharmonie
Artikel über Nina Tschernjawskaja auf der Website der Philharmonie
Artikel über Matwej Lwowitsch Frolow auf der Website der Bibliotheken der Petrograder Seite